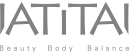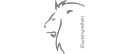Die Heilkraft der Liebe in der Medizin
Es kommt darauf an, dass wir unser Herz wirklich öffnen.
Ein Gespräch mit Dean Ornish über die verkannte Heilkraft der Liebe in der Medizin.
Ornish gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Neuen Medizin. Mit seinem Buch "Love and Survival" (Die Heilkraft der Liebe) hat er ein Grundlagenwerk über die wissenschaftlichen Hintergründe der Heilkraft der Liebe, Geborgenheit und menschlichen Zuwendung in der Medizin vorgelegt.
Im folgenden Interview - abgedruckt in "PSYCHOLOGIE HEUTE" (Dezember 1998) äußert er sich über die wichtigsten Zusammenhänge seiner neuen Forschung.
Psychologie Heute: "Liebe und zwischenmenschliche Nähe machen gesund!" lautet Ihre jüngste Botschaft. Sind das neue Ideen, oder war Ihnen schon länger bewußt, daß jede medizinische Behandlung auf emotionaler Zuwendung beruhen sollte?
Ornish: Die Botschaft ist nicht neu - sie ist nur noch nicht richtig gehört und verstanden worden. Das menschliche Miteinander und Mitfühlen waren immer Teil meiner Arbeit, schon im ersten Herzbuch habe ich viel darüber reflektiert. Merkwürdigerweise haben dies die meisten Menschen aber kaum beachtet, so bezog sich die öffentliche Aufmerksamkeit fast ausnahmslos auf die Ernährung, teilweise auf die Yoga und Meditationsübungen. Der wichtigste Teil der Herztherapie - die psychologische Gruppenarbeit - wurde dagegen nie richtig erwähnt und gewürdigt.
Um dies zu ändern, habe ich mich noch intensiver mit der"Heilkraft der Liebe" beschäftigt und das Buch geschrieben. Während dieser Arbeit habe ich Hunderte von Studien analysiert und dabei noch viel mehr von der Macht dieser Ansätze begriffen, weil sie beweisen, wie krank emotionale Isolation die Menschen macht, verglichen mit denjenigen, die in ihrem Leben so etwas wie Liebe und Verbundenheit erfahren. So kann alles, was Einsamkeit fördert, krank machen. Umgekehrt wirkt alles, was Gefühle der Gemeinschaft und Nähe fördert, auch heilend auf den Menschen.
Ich bin heute davon überzeugt, dass psychische Achtsamkeit den ersten Schritt jeder Heilung darstellt. Es ist entscheidend, dass man sich anderen und sich selbst gegenüber stärker öffnet - was ungewohnt und schwierig sein kann, da wir nur in dem Maße anderen nahe sein können, in dem wir uns selbst verletzbar machen. in unserer Kultur haben viele Menschen keinen Ort, an dem sie sich sicher genug fühlen, um anderen nahe oder vertraut zu werden. Falls sich die Menschen aber bewusst machen, welch existentiellen Unterschied Liebe und vertraute Nähe bringen - nicht nur in der Lebensqualität, sondern auch in der Lebensdauer -, dürfte es vielen leichter fallen, sich zu öffnen.
Es kommt hinzu, dass wir in der Medizin gegenwärtig einen Backlash gegen die alternative und komplementäre Medizin erleben, weil sie wissenschaftlich nicht so erfolgreich ist, wie sich das viele wünschen - wobei teilweise unerfüllbare Standards gefordert werden. Wissenschaft ist zwar ein hervorragendes Mittel, um zu zeigen, was funktioniert und was nicht. So sind viele der vorliegenden Studien mit Tausenden von Fällen wissenschaftlich vor allem deswegen bedeutsam, weil der heilende Effekt gerade auch dann nachweisbar war, wenn man Risikofaktoren wie Rauchen, Erbe oder Ernährung kontrolliert hatte. Warum das so ist, ist noch unklar - aber die Tatsache selbst kann nicht mehr bezweifelt werden. Wir können mit wissenschaftlichen Methoden also nachweisen, dass Einsamkeit krank macht - wir können damit aber niemals erklären, warum das so ist.
Deswegen habe ich auch von harten Schulmedizinern bis zu "intuitiven Heilern" viele Experten befragt, warum Faktoren wie Liebe und Einsamkeit medizinisch so signifikant sind. Die Schulmediziner fühlten sich dabei offensichtlich nicht besonders wohl in ihrer Haut: Sie bekundeten zwar ausnahmslos, vom Phänomen überzeugt zu sein, die vorliegenden Daten reichten aber dennoch nicht aus, irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Viele meinten auch, dass sich dies irgendwann in rein rationalen Zusammenhängen "neuronaler Mechanismen" erklären lasse. Dies zeigt mir, dass das "Entweder-Oder-Denken" in der Medizin immer noch viel zu stark ausgeprägt ist - so schwören neben vielen Ärzten auch viele Patienten entweder auf die traditionelle oder alternative Behandlung. Wir sollten aber vom ganzen Heilungswissen profitieren und nicht mehr von traditioneller oder alternativer Medizin sprechen, sondern nur noch von der Medizin, die heilt oder nicht.
PH: Sie betonen, daß viele Ärzte mittlerweile zwar bereit sind, sich auf einige Ihrer Behandlungsideen wie eine geänderte Ernährung einzulassen, vor der "emotionalen Hingabe" in der Behandlung aber zurückschrecken.
Ornish: Ich denke, es ist in der Medizin längst überholt, dass wir nicht involviert sind. Wir haben uns von der Lebenskraft abgeschnitten, die fließt, sobald zwei Menschen füreinander sorgen. Fürsorge und Verständnis waren schon immer Teil der Heilkunst - nur hat sich die Naturwissenschaft dem Gebot verschrieben, was nicht meßbar ist, als unwichtig oder nicht existent abzutun. So kann man Cholesterin, Blutdruck und jede Form verengter Herzarterien hervorragend messen, aber wie soll man das mit Liebe oder Mitgefühl machen? Daher neigen viele Mediziner dazu, sich mit einem kleineren Teil des großen Ganzen zufriedenzugeben.
Obwohl die meisten alternativen Methoden nur wenig wissenschaftliche Belege vormerken können, haben sie so großen Zulauf, weil Akupunkteure, Chiropraktiker oder Körpertherapeuten und viele andere so auf ihre Klienten eingehen, dass diese sich angenommen und verstanden fühlen. Dies sind die entscheidenden Bedürfnisse, die bei vielen Ärzten meist unbefriedigt bleiben.
Wenn man etwa mit unseren Patienten darüber spricht, was für sie bei der Herztherapie am wichtigsten und hilfreichsten war, schwierige Lebensstiländerungen - das Rauchen aufgeben, Bewegung, fettarme Ernährung - zu vollziehen oder was auch immer, dann lautet die Antwort praktisch ausnahmslos: die Heilkraft von Liebe und Intimität. Sie sprechen davon, wie sie ihr "Herz öffneten", Gemeinschaft schufen und Verbindungen zu anderen herstellten.
In der Medizin sind wir aber daran gewöhnt, unsere Gefühle abzuspalten und nichts mit ihnen zu tun zu haben - sicherlich der wichtigste Grund dafür, daß die Ärzte zu den depressivsten Berufsständen zählen: Wir sterben nicht nur zehn Jahre früher, sondern haben vergleichsweise auch die höchsten Scheidungs-, Sucht- und Suizidraten. Es kommt hinzu, dass die Ärzte nicht nur keine Belohnung bekommen, wenn sie eine aufwendigere emotionale oder "sprechende Medizin" betreiben, sondern immer noch lächerlich gemacht werden. In den USA wird das beispielsweise als "kalifornische Behandlung" verspottet. Tatsache ist aber, daß wir "touchy-feel-Wesen" sind, die körperliche Berührung, emotionale Gemeinschaft und vor allem seelische Bindungen zu anderen brauchen. Dies ist die Art und Weise, wie wir evolutionär überlebt haben - bisher zumindest.
PH: Sie heben hervor, daß die Menschen nicht die Einsamkeit an sich krank macht oder das Leben verkürzt, sondern die Erfahrung, sich einsam zu fühlen. Können Sie sich eine gewandelte Schulmedizin vorstellen, die Ihre Ideen heilender "Nächstenliebe" praktiziert?
Ornish: Es wäre schrecklich, falls Krankenhäuser beispielsweise dazu übergingen, für alle Patienten einfach nur "Therapiegruppen" anzubieten - ohne Leitung oder ähnliches. Heilende Nähe kann man nicht verordnen. So kann man auch in einer Klinik genauso fürchterlich einsam sein wie auf einer überfüllten New Yorker Avenue. Umgekehrt können sie irgendwo in den einsamsten Bergen meditieren und in einem transzendenten, "übernatürlichen" Gefühl von Geborgenheit eintauchen. Es sind weniger die Handlungen, die zählen, sondern die unmittelbaren Erfahrungen und die tiefer liegenden Einstellungen.
PH: Bedeutet dies, dass frühere Lebenserfahrungen mangelnder Liebe und Nähe später "ausgeglichen" werden können?
Ornish: Ja. Die meisten Menschen achten nicht sonderlich auf Fragen zwischenmenschlicher Intimität - weil sie in unserer Kultur nicht wertvoll genug erscheinen. Und falls sie die erforderlichen "sozialen Kompetenzen" nicht in ihrer Ursprungsfamilie erfahren haben oder nicht offen genug sein konnten, dann neigen sie dazu, als Erwachsener ähnlich defensive Beziehungen zu leben wie als Heranwachsende. Wenn Nähe früh im Leben als gefährlich erfahren wurde, dann sucht man später unbewußt oft Beziehungen, in denen man nicht zu offen oder ängstlich sein muss. Dies ist gefährlich, denn solche Verhaltensweisen bleiben ein Selbstläufer, wenn sie nicht durch Therapie oder andere Ansätze in neue Bahnen gelenkt werden.
So zeigt eine Harvard-Langzeitstudie, dass diejenigen Erwachsenen am ungesündesten waren, die früher am wenigsten Geborgenheit erlebten. Auf der anderen Seite verdeutlichen viele Studien, dass wir dies ändern können: Wir brauchen zwar die Hilfe von anderen, aber falls wir diese annehmen und uns öffnen - selbst wenn es sich nur um sechs Wochen oder ein Jahr in einer Therapie- oder Selbsthilfegruppe handelt -, können wir unsere Lebenschancen verdoppeln, wenn wir an schweren Krankheiten leiden.
Dabei wirken bei vielen Patienten nicht so sehr die wenigen Wochen therapeutischen Gruppenkontakts so heilsam, vielmehr ist es das Erlebnis, wie gut es tut, wenn man mit anderen zu tun hat, Risiken eingeht und "verwundbar" sein kann.
Es gibt unzählige Wege, auf denen wir das Einssein und die Verbundenheit erfahren können. Für mich selbst waren beispielsweise Yoga und Meditation sehr mächtige "Werkzeuge" - aber es gibt auch Vertrauen, Hingabe, Vergebenkönnen und Verzeihen, Altruismus oder andere Formen der Gemeinschaftserfahrung, selbst freundliche Berührungen oder Massagen können kleine Wunder wirken.